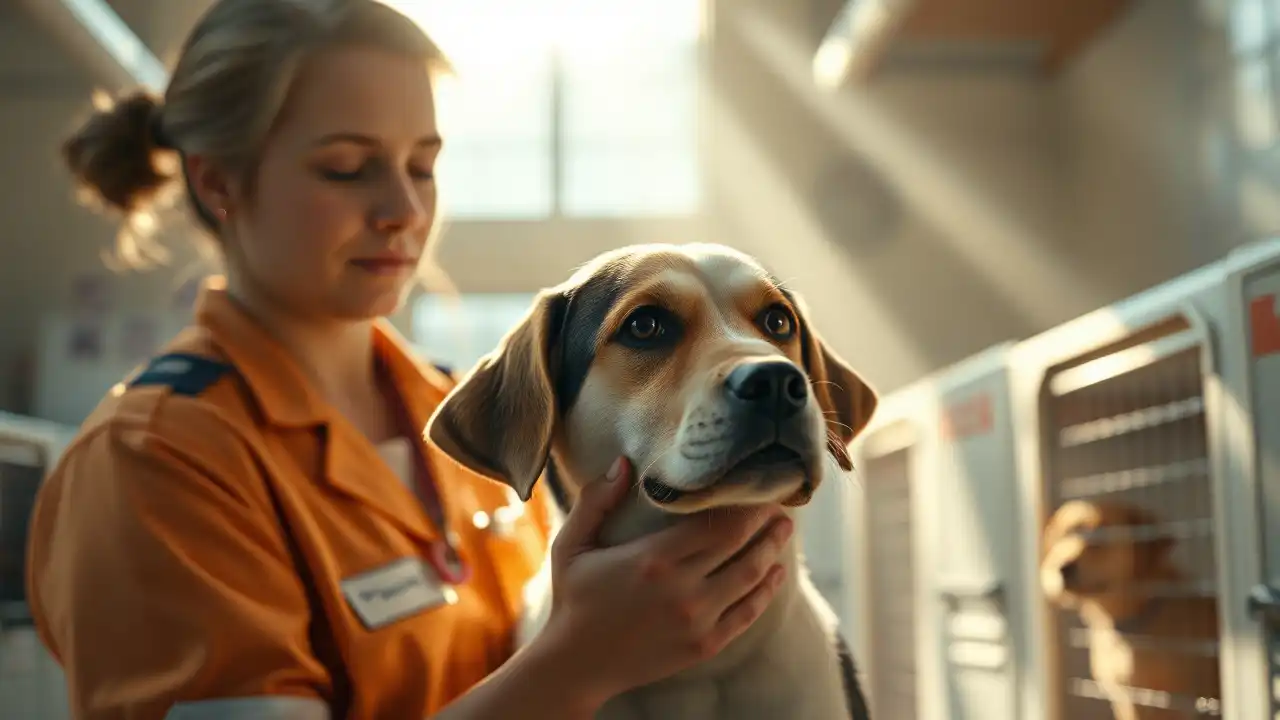Wenn Engagement zur Struktur wird
Der nationale Meldestelle Tierschutz des Schweizer Tierschutzes (STS) ist mehr als nur eine Reaktion auf einen tragischen Vorfall – sie ist ein Signal. Nachdem in Ramiswil rund 120 Hunde eingeschläfert werden mussten, wurde deutlich, wie fragil das Vertrauen der Bevölkerung in Behörden sein kann. Wo Missstände aufgedeckt werden, braucht es Strukturen, die verhindern, dass solche Tragödien erneut geschehen.
Deutschland sollte hier aufmerksam hinschauen. Wenn die Schweiz den Mut hat, aus Fehlern zu lernen, warum fehlt bei uns der politische Wille, solche Meldestellen staatlich zu fördern und mit echten Kompetenzen auszustatten?
Ramiswil als Wendepunkt
Der Fall Ramiswil war einer der schwerwiegendsten Fälle von Tierquälerei Schweiz in den letzten Jahren. Rund 120 Hunde mussten eingeschläfert werden, Dutzende weitere Tiere wurden beschlagnahmt. Der Schweizer Tierschutz zeigte sich erschüttert und forderte nicht nur eine lückenlose Aufklärung, sondern auch eine personelle Stärkung der kantonalen Veterinärämter.
Der STS erkannte: Solche Katastrophen entstehen nicht über Nacht. Sie sind das Resultat von Überforderung, fehlenden Kontrollen und einem unzureichenden System, das Vertrauensverlust Behörden geradezu provoziert.
Ein dichtes Netz für den Tierschutz
Die Schweizer reagierten konsequent. Ab 2026 soll eine personell verstärkte Meldestelle Tierschutz entstehen, die Verdachtsfälle von Tierquälerei und Tierhandel illegal entgegennimmt, prüft und schnell reagiert. Ziel ist es, Missstände frühzeitig zu erkennen und im Sinne der Tiere zu handeln – ein praxisorientierter Ansatz, den man in Deutschland vergeblich sucht.
Hierzulande verlässt man sich stattdessen auf überlastete Veterinärämter und überforderte Ehrenamtliche. Von einer zentralen, gut ausgestatteten Struktur wie in der Schweiz kann keine Rede sein. Dabei wäre gerade das Zusammenspiel von Behörden, Organisationen und Bürgern der Schlüssel zu einer funktionierenden Prävention.
Die Bedeutung von Transparenz und Vertrauen
Der STS fordert mehr als nur Reaktionen – er verlangt Transparenz. Nur wenn klar kommuniziert wird, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, bleibt die Bevölkerung bereit, Missstände zu melden. Ohne Vertrauen nützt selbst das beste Gesetz nichts.
In Deutschland hingegen werden Anzeigen wegen Tierquälerei oft in bürokratischen Abläufen zerrieben. Hier braucht es Strukturen, die nicht nur aufnehmen, sondern auch handeln. Veterinärämter Ausstattung und eine bundesweite Koordination sind längst überfällig.
Ein Modell für Deutschland
Warum also nicht dem Schweizer Beispiel folgen? Eine staatlich geförderte, unabhängige Meldestelle könnte auch hierzulande dafür sorgen, dass Fälle von Tiermisshandlung, Vernachlässigung oder illegalem Tierhandel systematisch erfasst und verfolgt werden.
Es wäre ein Schritt hin zu echter Prävention Tiermissstände – weg vom reaktiven Krisenmodus, hin zu einem modernen, transparenten Tierschutzsystem. Dass die Schweiz diesen Weg geht, zeigt: Wille und Struktur schließen sich nicht aus – sie bedingen einander.
Fazit: Lernen heißt handeln
Die Schweiz hat erkannt, dass Tierschutz kein Schönwetterthema ist, sondern eine dauerhafte Aufgabe. Die Einrichtung einer nationalen Meldestelle Tierschutz beweist Weitsicht – und Mut zur Verantwortung. Deutschland sollte sich ein Beispiel nehmen und ähnliche Strukturen schaffen, die staatlich unterstützt und verbindlich verankert sind.
Denn nur wer Missstände ernsthaft aufklären will, muss auch bereit sein, in die Strukturen zu investieren, die sie verhindern.
Quellen:
- TierWelt – Schweizer Tierschutz baut Meldestelle gegen Tierquälerei aus – https://www.tierwelt.ch/artikel/hunde/schweizer-tierschutz-baut-nationale-meldestelle-gegen-tierquaelerei-aus-0-553491
- GERATI – Im Jahr 2023 wurden mehr als 280 Tierquälerei in Thüringen registriert. – https://gerati.de/2024/01/09/tierquaelerei-in-thueringen-registriert/